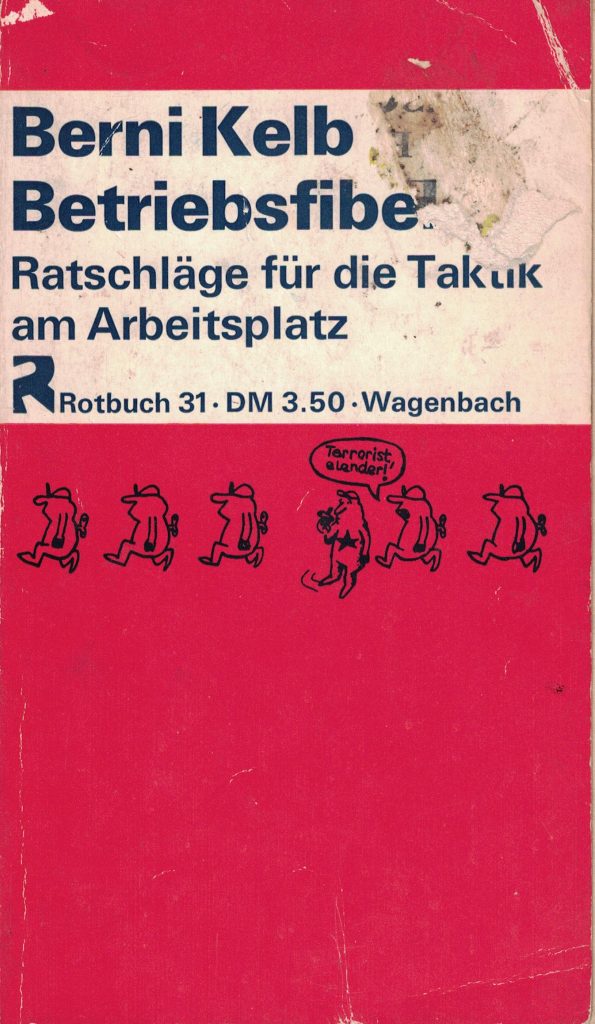von Gaston Kirsche
pdf-Toluol-Wechselschicht-Rotationsdruckmaschinen
https://jungle.world/artikel/2020/45/monotonie-und-rotation
Toluol,
Wechselschicht und Rotationsdruckmaschinen
1984
begann ich eine Ausbildung zum Tiefdrucker, nach der Lehre wurde ich
bei Broschek übernommen. Das Arbeiten mit krebserregenden Farben,
Nachtschichten für die schnellere Akkumulation der kapitalintensiven
großen Rotationsdruckmaschinen, aber auch die Hilfsbereitschaft der
Kollegen haben mich geprägt.
Der
Tiefpunkt war meistens so zwischen zwei und drei Uhr morgens. Der
Körper will schlafen und versteht nicht, warum er hier an der
Rotation steht. Die Papierbahn rast durch die zehn Druckwerke,
überall Papierstaub, trotz der Ohrstöpsel ist es laut. Der
Maschinenkontrollstand ist außerhalb der Box, in der die
dreistöckige Druckmaschine läuft. Aber für jeden Arbeitsschritt
direkt an der Maschine wird die Tür der Box geöffnet, ran an die
vibrierenden Druckwerke, es ist stickig und warm, eine Verständigung
ist hier nur durch Brüllen möglich. Im Sommer läuft der Schweiß.
Die tonnenschweren Druckzylinder rotieren, auf der
Druckmaschinenverkleidung klebt ein dünner Film. Eine Verbindung aus
dem Schmieröl, das bei der hohen Laufgeschwindigkeit zwischen den
Achsen der Druckzylinder und den Lagern verdunstet, Metallabrieb von
den Rakelmessern, mit welchen die überschüssige Farbe vom
Druckzylinder abgezogen wird, unzähligen kleinsten Papierfasern und
Lösemitteldämpfen. Wenn es einen Reißer gibt, müssen alle Drucker
rein und die über drei Meter sechzig breite Papierbahn über die
Laufstangen wieder durch die zehn Druckwerke führen. Fünf für
den Schöndruck, fünf für den Widerdruck. In den Farbwannen
schwimmt die dünnflüssige Druckfarbe auf Toluolbasis. Toluol stand
da schon lange im Verdacht, krebserregend zu sein. Dass wurde durch
die Studie Toluol in Tiefdruckereien* des Instituts für
Arbeitsphysiologie an der Universität Dortmund aus dem Jahr 2001
aber nicht bestätigt. Allerdings wurden Gesundheitsschäden im
Allgemeinen durch Toluol in der Studie auch nicht ausgeschlossen.
Toluol
verdunstet bei niedrigeren Temperaturen als Wasser, etwa bei 80 Grad
Celsius. Im menschlichen Körper reichert es sich leicht an. Dass
meiste verdunstete Toluol aus den Farbwannen wird über riesige Rohre
mit Trichterförmigen Öffnungen abgesaugt, aber nicht alles.
Gearbeitet wird ohne Handschuhe, Farbreste werden mit in Toluol
getränkten Lappen abgewischt. Andere, nicht gesundheitsgefährdende
Lösungsmittel für die Tiefdruckfarben sind teurer. Also Toluol.
In einem Artikel stand 1994 in drei Absätzen etwas über die schädliche Wirkung von Toluol auf Menschen: Münchner Wissenschaftler hatten das Blut von Druckereiarbeitern aus Baden-Württemberg analysiert. Bei Beschäftigten, die länger als 16 Jahre im Tiefdruck arbeiteten, war die Anzahl von deformierten Erbinformationsträgern in den Zellen wesentlich höher als bei den Kollegen, die erst kürzer dabei waren. Da gab es Brüche in den Chromosomenärmchen, winzig kleine Verbindungsteilchen fehlten oder waren vertauscht. Solcherart Fehler in der genetischen Information können vermehrt entstehen, wenn die Reparaturmechanismen in der Zelle nicht mehr richtig funktionieren, hieß es unter der Überschrift: Wir lassen sie sterben: Bei ersten Gesundheitsuntersuchungen hatten die Drucker sich über ständig trockene Schleimhäute in Mund, Nase und Rachen beklagt. Sonst war nichts weiter aufgefallen.
Durchhalten, keine Schwäche zeigen: Als die Forscher sie jedoch einige Jahre später zur Nachuntersuchung baten, gab es eine böse Überraschung: 4 der insgesamt 60 untersuchten Tiefdrucker waren mittlerweile an Krebs gestorben. Der nicht namentlich gezeichnete Artikel erschien am 7. März 1994 in der Ausgabe 10/1994 von Der Spiegel. Gedruckt wurde auch diese Ausgabe in der Tiefdruckerei des Axel-Springer-Konzerns in Ahrensburg bei Hamburg wie üblich mit Farben auf Toluolbasis. Eine Umweltschutzorganisation, meiner Erinnerung nach Greenpeace, ließ in den 80iger Jahren Exemplare von Der Spiegel in einer einmaligen Aktion ohne Toluolfarben nachdrucken und verteilen. Die Leser*innen sollten sich nicht mit den Rückständen der toluolhaltigen Farben vergiften, war der Tenor der Aktion. Über die in der Druckerei Arbeitenden, die am meisten unter der Schadstoffbelastung litten, wurde bei der Aktion geschwiegen. Selten wurde mir deutlicher, wie falsch es ist, ökologische Forderungen ohne gleichzeitige Kritik an den Produktionsbedingungen und dem Dogma der Kapitalverwertung zu stellen.
Zurück
zur Nachtschicht an der Tiefdruckrotationsmaschine. Gedruckt wird der
jährliche IKEA-Katalog, in Millionenauflage. Heute ist der
Druckbogen mit den Betten dran, die ganze Nacht durch: 32
Katalogseiten mit Betten, Matratzen, Decken, Bezügen. Aber anstatt
im Bett zu liegen, achte ich auf den Passer beim Fortdruck. Die
gesamte Maschinenbesetzung reagiert nachts um zwei fahriger als
sonst, wenn beim Rollenwechsel die Papierbahn reißt, der Passer
nicht mehr stimmt oder Dreck an einem Rakelmesser ist. Es arbeiten
mehr Drucker an den Maschinen als der Verband der Druckindustrie
möchte. Einer kann immer Pause machen. Tarifvertraglich geregelt,
durch Streiks erkämpft: Der Manteltarifvertrag mit genauen Angaben
zur Maschinenbesetzung. Gilt und galt aber nur in tarifgebundenen
Betrieben. Die Druckerei Broschek, in der ich arbeitete, war für
ihren hohen gewerkschaftlichen Organisationsgrad und einen
kämpferischen Betriebsrat bekannt. In der Belegschaft wurde auf die
Einhaltung der tariflichen Vereinbarungen seitens der
Geschäftsleitung und der Vorgensetzen geachtet. Zwei von der
Maschinenbesetzung, ein Drucker und ein Helfer, waren im Pausenraum
neben dem Drucksaal, wie die unwirtliche, rein funktional
eingerichtete Fabrikhalle genannt wurde. Wenn sie nach 30 Minuten aus
der Pause zurückkamen, konnten die nächsten gehen.
Noch
weit entfernt war in den 80iger Jahren eine Besserung bei den
gesundheitsschädlichen Arbeitsbedingungen. Denn: der Lärm, die
Toluoldämpfe all das musste nicht sein. Erst im Laufe der 1990er
Jahre wurde Toluol als Lösungsmittel in den Farbrezepturen ersetzt.
Maßgeblich hierfür waren Kampagnen von Seiten der damaligen
Industriegewerkschaft Druck und Papier und ihrer
Schwesterorganisationen in Europa. Tatsächlich ist die
Druckindustrie seitdem, was Gesundheitsschutz und dann auch
Umweltschutz betrifft, ziemlich weit vorne es hat viel Einsatz der
Drucker und ihrer Gewerkschaften erfordert. Was erstmal blieb, war
die Kontaminierung der Böden. Broschek war eine der ersten
Industriedruckereien, die saniert wurden. Am 30. August 2019 erklärte
der Hamburger Senat als Antwort auf die Schriftliche Kleine Anfrage
eines Abgeordneten der CDU in der Drucksache 21/18127: Im Jahr 1992
wurden auf dem Gelände der Firma Broschek Bodenuntersuchungen
durchgeführt, bei denen großflächig Bodenverunreinigungen mit dem
eingesetzten Lösungsmittel Toluol festgestellt wurden. Danach
erfolgten umfangreiche Sanierungsmaßnahmen, die im Jahr 1996
abgeschlossen wurden.
Neben dem Lösungsmittel Toluol waren auch der Lärm und der Schichtbetrieb an den großen Rotationsmaschinen gesundheitlich stark belastend. Gearbeitet wurde in drei Schichten rund um die Uhr. Im wöchentlichen Wechsel, Frühschicht, Spätschicht und die Nachtschicht: Um 22 Uhr fängt die Arbeit an, um sechs Uhr morgens ist Feierabend. Freitagabends um 22 Uhr zum Schichtbeginn an der Rotationsdruckmaschine anzutreten war surreal. Klar gibt es gesellschaftlich notwendige Arbeit, die rund um die Uhr erledigt werden muss. Drucken gehört nicht dazu. Die großen Rotationsmaschinen sind teure Investitionen damit sie sich schneller amortisieren, laufen sie rund um die Uhr. Nachtschicht, Gesundheitsgefährdung für den Profit. Die starke Vernutzung durch Arbeit hat ihren Preis. Nicht alle erreichen überhaupt das Rentenalter.
Für Frauen war Nachtarbeit im produktiven Gewerbe aus Arbeitsschutz bis 1992 verboten – für Männer nicht. Dementsprechend war der Drucksaal eine absolute Männerdomäne, selbst die weiblichen Betriebsrätinnen aus anderen Abteilungen trauten sich kaum in den Drucksaal. In der Verwaltung arbeiteten viele Frauen, auch in der Buchbinderei. Die Druckvorstufe, wo die Druckvorlagen und die Druckformen in einer kleineren Abteilung hergestellt wurden die schweren Kupferzylinder mit Stahlkern arbeitete auch in Dreischicht und war eine Männerdomäne. In der Buchbinderei in einer weiteren Fabrikhalle wurden die an der Druckmaschine bereits gefalzten Vorprodukte durch Heftung oder Klebebindung zu Zeitschriften oder Katalogen weiterverarbeitet. Hier arbeiteten viele Frauen. Im Zweischichtbetrieb, keine Nachtschicht. Die Arbeitsbereiche waren strikt voneinander getrennt, wer in der Buchbinderei arbeitete sollte nicht in den Drucksaal gehen und umgekehrt man hatte auch genug mit der eigenen Arbeit zu tun und in den Pausen blieb man unter sich im eigenen Pausenraum der Abteilung.
Durch
das Arbeiten nur unter Männern, durch die gegenseitige
Selbstbestätigung im Lebensmittelpunkt Drucksaal wurden patriarchale
Muster reproduziert: Frauen sieht man Zuhause oder in der Freizeit.
An der Längsseite des Drucksaals standen verbeulte Metallschränke.
In diesen persönlichen Spinden für Essen und Trinken hingen meist
Fotos von nackten Frauen. Broschek war eine Akzidenzdruckerei das
heißt, sie war nicht an einen Verlag gebunden, sondern es wurden
alle möglichen Aufträge angenommen interessant fand ich die
Angebotskataloge der großen Supermarktkette Kmart aus den USA und
die Unterschiede in der Präsentation für das dortige Publikum. Über
einen großen Auftrag wurde im Drucksaal schon Tage vor dem Andruck
begeistert gesprochen, Kollegen hatten schon Teile davon in der
Druckvorstufe gesehen: Ein dickes Sonderheft vom Playboy mit
Klebebindung, es hieß Best-Of oder so. Einige Kollegen wollten für
sich ein Heft mitnehmen, die Anderen schwiegen dazu. Als an der
Andruckmaschine die üblichen Proben hergestellt wurden, um zu
prüfen, ob die Druckzylinder richtig graviert waren, der Passer
stimmte, die verschiedenen Farben passend übereinander gedruckt
wurden und die Farbdichte, die Farbtöne und die Brillanz okay waren,
kamen wesentlich mehr Kollegen als sonst von den Fortdruckmaschinen
mal zum Schauen in die Hallenecke, wo die Andruckmaschine stand. Die
nackten Frauen auf den Abbildungen werden ausführlich bewertet.
Patriarchat
und Rassismus prägen auch die Lohnarbeit und finden durch die
Rangordnung an den Arbeitsplätzen scheinbar Bestätigung, werden im
Bewusstsein reproduziert. Die qualifizierten Drucker am Maschinenpult
sind meist weiß und einsprachig, die Hilfsarbeiter im Papierkeller
und an den Maschinenauslagen, wo die gedruckten und gefalzten
Produkte abgelegt werden, sind in der Regel schwarzhaarig und
mehrsprachig. Wenn bei Stoppern Alle anpacken, um die Rotation wieder
ins Laufen zu bringen, oder beim Wechsel der Druckzylinder, beim
Wechsel der Rakelmesser immer haben der Maschinenführer und die
anderen Drucker das Kommando. Die anspruchsvollsten Arbeiten, etwa
die Farbdichtemessung mit dem Densitometer, um die Volltondichte, die
optische Dichte der Farben zu kontrollieren, erledigen
Maschinenführer und Drucker. Eine prägende Hierarchisierung.
Typisch für die traditionell verstandene Klasse aus weißen,
männlichen Facharbeitern. Frauen und Migrant*innen waren in der
klassischen Vorstellung von der Arbeiterklasse unsichtbar, der
Arbeiterstolz wurde von Männlichkeit und Stärke geprägt, das
körperliche Leiden an den Arbeitsbedingungen ignoriert.
Während
der Lehre zum Drucker Tiefdruck/Offset liefen der andere
Auszubildende und ich an den Maschinen mit, wir sollten in der
laufenden Produktion lernen. Eine Lehrwerkstatt gab es 1984 bei
Broschek nicht mehr wir versuchten uns möglichst viel abzugucken.
Einen Maschinenleitstand selbst zu dirigieren, habe ich erst zwei
Tage vor meiner praktischen Abschlussprüfung länger üben können.
Die große, dreistöckige Rotation selbst hochzufahren war eine tolle
Erfahrung. Aber in der laufenden Produktion war meine Tätigkeit ich
in der Regel auf das Erledigen kleinerer Arbeiten auf Zuruf
beschränkt. Und es gab Zuarbeiten, welche die Maschinenführer an
uns Auszubildende delegierten: Den Ölstand der Motorenblöcke der
Druckmaschinenmotoren im Papierkeller zu kontrollieren, oder neue
Rakelmesser in die Halterungen zu spannen. Die Rakelmesser nutzten
sich ab, spätestens wenn ein Druckzylinder sich eine halbe Million
Mal gedreht hatte, war die Schneide runter. Sie waren unverzichtbar,
denn an ihnen wurde die überschüssige Farbe abgestreift, wenn
nachdem ein Druckzylinder durch die Farbwanne gelaufen war: Nur in
den napfförmigen Vertiefungen, in den mikroskopisch klein
eingravierten Löchern in der Kupferbeschichtung der Druckzylinder
sollte die Farbe verbleiben, um auf die Papierbahn gedruckt zu
werden. Durch die unterschiedliche Tiefe der Löcher wurde
unterschiedlich viel Farbe auf das Papier gedruckt, so entstand die
feine Farbbrillanz, für die der Illustrationstiefdruck bekannt ist.
Die Rakelmesser waren dünne Stahlbänder, so lang wie die
Druckzylinder breit waren etwa 2, 64 Meter, wenn ich mich richtig
erinnere mit einer superscharfen feinen Schneide: dem Rakel, das
sich an den Druckzylinder andrückte. Beim Einsetzen der Rakelmesser
in die Halterungen brauchte man eigentlich Handschuhe, um sich nicht
zu schneiden aber dann hätte man nicht genug Feingefühl in den
Fingern, um das Blech millimetergenau und ohne Wellen zu justieren.
Die Narben an den Händen von den Schnitten, wenn mal was schiefging,
sind mir geblieben. Da wir Auszubildenden nur zwei Pausen hatten,
entzog ich mich dem Lärm, den Tolouldämpfen und der Monotonie an
der Rotation manchmal in eine Toilette. Die meisten Kollegen deckten
es hilfsbereit, wenn wir Azubis mal raus wollten. Wenn ich dort ein
paar Minuten saß, spürte ich, wie ich mich in meinem eigenen Körper
ins Innerste verkrochen hatte. Die äußere Hülle meines Körpers
war mir fremd, schmutzig, Farb- und Lösemittelrückstände bis in
die Haarspitzen. Die Gemeinschaftsduschen waren zum Feierabend der
Ort des Auflebens.
Diese Erfahrung von mir liegt über dreißig Jahre zurück, meine erste Erfahrung mit Lohnarbeit. Die Tiefdruckerei Broschek, in der ich in den 80igern arbeitete, hatte einen links dominierten Betriebsrat dessen damalige stellvertretende Vorsitzende der Zeitschrift Konkret ein Interview zum Thema Sexismus im Betrieb gegeben hatte, woraufhin sie fristlos gekündigt wurde. Es waren vor allem die Chefs mit Schlips in der Verwaltung, deren sexistisches Verhalten, deren Sprüche sie im Interview prägnant kritisiert hatte. Die engagierte Betriebsrätin gewann aber die Prozesse auf Wiedereinstellung. Mehrere Betriebsräte auch sie – waren erst wieder in die Industriegewerkschaft (IG) Druck und Papier aufgenommen worden, nachdem sie infolge der Unvereinbarkeitsbeschlüsse der DGB-Gewerkschaften als Mitglieder des Kommunistischen Bundes (KB) in den 1970iger Jahren ausgeschlossen worden waren. In der IG Druck und Papier hieß die entsprechende Maßgabe zwar Abgrenzungsbeschluss, aber es ging um das gleiche: Den Ausschluss gewerkschaftsoppositioneller radikaler Linker, vor allem von betrieblich aktiven Mitgliedern von K-Gruppen – kommunistischen Vereinigungen links von der DKP.
Bei Warnstreiks in den Tarifrunden war Broschek immer vorneweg dabei: Mehr Lohn, bessere Arbeitsbedingungen dafür stand eine Mehrheit der Beschäftigten ein. Wenn es nötig war, was alle zwei, drei Jahre vorkam, ließ sich die Belegschaft in Tarifrunden innerhalb weniger Stunden zum Warnstreik vor das Fabriktor am Bargkoppelweg 61 rufen, um einer Gewerkschaftsforderung Nachdruck zu verleihen. Als Auszubildender und danach habe ich im Drucksaal viel kollegiale Unterstützung erleben können. Trotzdem war das Klassenbewusstsein durchwachsen. Klar für mehr Lohn, für einen starken Betriebsrat. Aber schon beim Einsatz für eine kämpferische Gewerkschaft war den meisten das eigene kleine Glück wichtiger. Es gab Konkurrenz, es gab Sexismus, Rassismus. Ein Kollege schwärmte davon, nach Südafrika auswandern zu wollen, das damals noch ein Apartheidsstaat war. Und der eigene Hausbau war wichtiger als Politik. Sicher hing dass auch mit Enttäuschungen zusammen, mit Resignation. Aber das Bewusstsein, sich als Klasse formieren zu wollen, politisch kämpfen zu wollen, über den eigenen Tellerrand hinaus dass war eher randständig.
Die
Druckindustrie hatte in den 80igern schon die technologische
Umwälzung durch elektronische Daten- und Textverarbeitung und den
Einsatz von Mikroprozessoren hinter sich der Bleisatz etwa war
Geschichte. Während die Streiks 1973 und 1976 noch vorrangig
Lohnstreiks gewesen waren, versuchte die IG Druck und Papier danach,
die durch Digitalisierung neu mögliche Rationalisierung zu
entschleunigen und sozial zu gestalten. Auch der Arbeitsschutz
spielte schon eine Rolle. Bei den Streiks 1978 ging es um den
Rationalisierungsschutz für Setzer. So gab es einen von beiden
Seiten hart geführten Arbeitskampf in der Druckindustrie: Die im DGB
damals Linksaußen stehende IG Druck und Papier forderte einen
Ausgleich für Rationalisierungen, sichere Arbeitsplätze und
menschenwürdige Arbeitsbedingungen. Der Streik endete mit der
Vereinbarung des als RTS-Vertrag in die Gewerkschaftsgeschichte
eingegangenen Vereinbarung: Den Tarifvertrag über die Einführung
und Anwendung rechnergestützter Textsysteme. Auch wenn die
Berufsgruppe der Schriftsetzer trotzdem verschwand: Der
Arbeitsplatzabbau konnte zum einen verlangsamt werden, zum anderen
wurden viele Setzer zu Angestellten in den Redaktionen. Beim Streik
1984 ging es um die 35-Stundenwoche, nach 12 langen und harten Wochen
Streik konnte deren stufenweise Einführung bis im Jahr 1996 im
Tarifvertrag erreicht werden allerdings war der Unternehmerverband
der Druckindustrie nur um den Preis der Zustimmung der IG Druck und
Papier zu weitgehenden Flexibilisierungsmöglichkeiten zu Lasten der
Beschäftigten dazu bereit. Die Zustimmung zur Flexibilisierung hat
bis heute negative Folgen für die Beschäftigten der Druckindustrie.
Nicht nur der Beruf des Setzers ist verschwunden aus sieben Berufen der Druckvorstufe, von der Reprofotografie über Elektronische Bildbearbeitung bis hin zur Tiefdruckretusche, ist mittlerweile ein einziger geworden: Die Mediengestalterin print/digital. 2018 arbeiteten nur noch 131.700 Menschen in der Druckindustrie in sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen. Die Zahl der Beschäftigten ist seit 1975 rückläufig. Gegenüber dem Stand von 1980 (223.864) ist die Zahl der Beschäftigten um rund 41 Prozent gesunken (Zahlen des Bundesverbandes Druck und Medien). Der Umsatz ist dabei bis 2000 stark angestiegen und stagniert seitdem bei etwa 20 Milliarden Euro. Seit 2001 nahm die Zahl der Druck-Betriebe innerhalb von etwas mehr als 10 Jahren bundesweit um 30 Prozent ab, ebenfalls die Zahl der Beschäftigten, so Martin Dieckmann, der frühere Leiter des Fachbereichs Medien in der Gewerkschaft ver.di in Hamburg und Nord einen guten Überblick erworben hat: Besonders hart traf es die Betriebe mit mehr als 500 Beschäftigten, mit einem Niedergang um 60 Prozent und der Beschäftigten dort ebenfalls um 60 Prozent, teils durch Schließungen, teils durch reines Schrumpfen Hier wurde am stärksten rationalisiert: Bei den Zahlen spielt auch die dramatische Schrumpfung des Personals durch neue Maschinengenerationen eine Rolle: Seit Anfang der 200er Jahre kamen etwa im Zeitungs-Druck und auch in der Weiterverarbeitung auf den Markt, die teilweise zur Halbierung nicht nur des Drucksaals sondern auch der Weiterverarbeitung führten, so Martin Dieckmann.
Insbesondere
im Tiefdruck gab und gibt es europaweit große Überkapazitäten.
Seit 2005 hat sich die Konkurrenz verschärft, infolge der
kapitalintensiven Konzentration
auf zwei Konzerne: 2002 weitete sich die süddeutsche
Schlott-Firmengruppe zum Konzern aus, gab Aktien aus und kaufte
massiv zu; 2002 auch Broschek. Dagegen formierte sich mit Prinovis
die EU-weit größte Zusammenschluss von Tiefdruckereien der Konzerne
Springer, Bertelsmann und Gruner + Jahr. Überkapazitäten und der
folgende brutale Preiskampf, wie Martin Dieckmann es auf den
Punkt bringt, führten zu einer Serie von Betriebsschließungen,
darunter Prinovis Darmstadt, Bauer-Druck in Köln und 2011 zur
Insolvenz der Schlott AG. Während sich für fünf süddeutsche
Schlott-Betriebe neue Besitzer fanden, wurde die Hamburger Druckerei
Broschek nicht verkauft, sondern geschlossen. Seriöse Kaufangebote
gab es nicht, stattdessen hatten Betriebsrat, Gewerkschaft und Stadt
einige Mühe, ein windiges Angebot eines branchenweit bekannten
Abenteurers abzuwehren.
In
der Nacht vom 12. auf den 13. April 2011 wurden die Druckmaschinen
bei Broschek eine nach der anderen ein letztes Mal runtergefahren.
Stille im Drucksaal. Im Dezember, einen Tag vor Weihnachten,
verließ der Betriebsratsvorsitzende Kai Schliemann als Letzter den
Betrieb. Broschek war Geschichte. Heute gibt es nur noch wenige
Tiefdruckereien, selbst der Ikea-Katalog erscheint nicht mehr
gedruckt.
Die Schrumpfung und Konzentration im Tiefdruck gingen weiter: Am 2. Mai 2014 verließ die letzte Schicht die seitdem geschlossene Tiefdruckerei von Prinovis in Itzehoe. Anders als bei Broschek konnte die Belegschaft in Itzehoe mit ihren in der Stadt breit unterstützten Aktionen immerhin einen sehr guten Sozialplan mit hohen Abfindungen und einer Transfergesellschaft erreichen. Denn die Schließung von Prinovis Itzehoe wurde anderthalb Jahre zuvor angekündigt und der Bertelsmann-Konzern kam am Ende für die Kosten des gesamten Sozialplans auf. Bei Broschek war es schwieriger. Hier ließ die Insolvenz der gesamten Schlott AG keinen Spielraum für Verhandlungen über einen guten Sozialplan zu: Es war kein Geld mehr für Abfindungen vorhanden, geschweige denn für eine zusätzliche Transfergesellschaft. Die modernen Tiefdruckaggregate bei Broschek wurden an andere Druckereien verkauft. Das Gelände von Broschek liegt heute brach, die Gebäude wurden vorletztes Jahr abgerissen. Gaston Kirsche
*Die
Studie »Toluol in Tiefdruckereien« war vom Hauptverband der
gewerblichen Berufsgenossenschaften beauftragt und u.a. vom
Bundesverband Druck und Medien sowie ver.di unterstützt worden.
Der
Niedergang des Tiefdrucks
Komplett
geschlossen wurden
-1997:
Burda, Darmstadt (600 Beschäftigte)
-2008:
Prinovis in Darmstadt (fast 300)
-2008:
Metz, Aachen (40)
-2010:
Bauer Druck, Köln (knapp 400)
-2011:
Broschek in Hamburg (200)
-2011:
Schlott in Freudenstadt (300)
-2013:
Badenia in Karlsruhe (100)
-2014:
Prinovis in Itzehoe (750 plus 250*)
-2015:
Bruckmann, Oberschleißheim (130)
-2021:
Prinovis in Nürnberg (zuletzt 460)
*Werkvertrags-
und Leiharbeitskräfte
Innerhalb von 24 Jahren haben alleine durch Betriebsschließungen über 3.500 Menschen ihre Arbeit im Tiefdruck verloren. Insgesamt wurden viel mehr Leute entlassen: Viele gingen vorzeitig in Rente, schieden per Freiwilligenprogramm aus, bei der Fluktuation im Betrieb freiwerdende Stellen wurden nicht wieder besetzt. Auch in anderen europäischen Ländern sind komplette Tiefdruckereien geschlossen worden. Quelle: ver.di/Fachbereich 8 Auf den Fotos sind Proteste gegen die Schließung von Prinovis Itzehoe 2013 zu sehen. Nachweis: verdi/Fachbereich 8
Interview
mit Olaf Berg über seine dreijährige Ausbildung in der Druckerei
der Axel Springer Verlag AG in Ahrensburg.
In
den 80iger Jahren wurde in der Druckindustrie stark rationalisiert
und Arbeit verdichtet. Durch Flexibilisierung und Auslagerung von
Betriebsteilen wurden ehemals kämpferische Belegschaften
verkleinert, Abteilungen gegeneinander Konkurrenz gesetzt. So wurden
die Lohnarbeitenden der Branche, welche 1984 erfolgreich als erste
die Arbeitszeitverkürzung zur 35-Stundenwoche erstreikt hatten
nachhaltig verunsichert.
(Gaston
Kirsche)
Du hast 1987 in der Druckerei von Springer in Ahrensburg eine Lehre als Druckvorlagenhersteller begonnen?
Ja, als ich 1987 bei Springer angefangen habe, war der große Druckerstreik von 1984 schon Geschichte. Aber es gab noch eine grundsätzliche Kampf- und Streikbereitschaft und das Bewusstsein, etwas durchsetzen zu können. Es gab aber keine systematische Ansprache von uns neuen Azubis auf Mitgliedschaft in der Gewerkschaft. Ich musste da von mir aus aktiv werden und geriet auf das Treffen der IG Druck & Papier Jugend, auf dem diese sich gerade auflösen wollte, weil sich die Teilnehmenden alle als zu alt empfanden. Den Ortsverein in Ahrensburg, fast identisch mit der Betriebsgruppe von Springer in Ahrensburg, habe ich als ziemlich verschnarchte Versammlung älterer Männer empfunden. Gewerkschaftsarbeit war da weitestgehend kooptiertes Mitregulieren von Kleinigkeiten im Betriebsablauf und Umsetzen von Ansagen der Gewerkschaftsleitung.
Aber die Auswirkungen des 12-wöchigen Erzwingungsstreiks von 1984 waren für dich spürbar?
Ja,
auf mehreren Ebenen war der zu spüren. Ganz deutlich durch den
erreichten Einstieg in die 35- Stundenwoche, der während meiner
Lehre stattfand. Die 37-Stundenwoche wurde jedenfalls in der Zeit
meiner Ausbildung in Stufen eingeführt. Auch wenn wir die
35-Stundenwoche da noch nicht erreicht haben, war die halbe Stunde
weniger arbeiten am Tag für mich sehr deutlich zu spüren. Es war
nicht nur die halbe Stunde mehr Zeit, ich war auch einfach weniger
kaputt, um mit der Freizeit sinnvolles anzufangen.Die
Forderung nach der 35-Stundenwoche war in der Gewerkschaft nicht
unumstritten. Als gemeinsamer Nenner hat sie sich letztlich
durchgesetzt, weil diejenigen, die lieber mehr Lohn als mehr Zeit
haben wollten, darin das Potential für mehr Überstunden mit
entsprechendem Zuschlag entdeckten. Aber Jugendarbeitslosigkeit
war damals ein großes Thema. Die offiziellen Argumente waren
selbstverständlich gerechtere Verteilung der vorhandenen Arbeit auf
alle Arbeitenden und mehr Lebensqualität. Aus Klassenperspektive
hätte es besser gerechtere Verteilung der
gesellschaftlich notwendigen Arbeit heißen müssen.
War noch etwas von der Erfahrung von 1984 zu spüren, durch einen harten Streik eine Arbeitszeitverkürzung erzwungen zu haben?
Es
gab
eine Grundstimmung im Betrieb, gemeinsam etwas erreichen zu können.
Ich würde das nicht als Klassenbewusstsein überschätzen. Es war
eher die Erfahrung, über die Gewerkschaft Lohnerhöhungen und
Arbeitsverbesserungen durchzusetzen. Dafür gab es eingespielte
Rituale der Eskalationsstufen, bei denen die große Mehrheit der
Arbeitenden mitmachte. Dass lernte ich als drei Stufen
kennen:Zuerst spontane
Betriebsversammlungen, wenn die Tarifrunde angelaufen war und in den
Abteilungen die Ansage die Runde machte, sich um 13 Uhr in der
Kantine zu versammeln, um sich vom Betriebsrat über den Stand der
Verhandlungen informieren zu lassen.Zweite
Stufe waren Warnstreiks
von ein paar Stunden, zu denen während der
laufenden Tarifverhandlungen aufgerufen wurde. Irgendwann wurde
es dann ernst die dritte Stufe und es gab ein oder zwei
Wochen Streik.Den Streik habe ich nur sehr bedingt mitbekommen, weil
der in meinen Berufsschulblock fiel und es die Absprache gab,
das es keinen Sinn macht, den Unterricht zu bestreiken. Auch die
Azubis im Betrieb sollten weiter zur Ausbildung gehen. Sie durften
nur in der Lehrwerkstatt arbeiten und konnten so auch die
Arbeitskraft der Ausbilder binden, damit die nicht in der Produktion
eingesetzt werden konnten. Das klappte soweit ich das mitbekommen
habe, ganz gut, aber die Gewerkschaft insgesamt war da nicht sehr
kampflustig und hat sich recht schnell geeinigt.
Wie reagierte die Kapitalseite?
Die Unternehmer reagierten auf
die durchgesetzten Verbesserungen der Arbeitsbedingungen mit
Tarifflucht und Auslagerung. Als ich bei Springer anfing, hatte
Gruner & Jahr mit seiner Druckerei in Itzehoe gerade den Austritt
aus dem Tarif erklärt und ein flexibilisiertes 4-Schicht-Modell
eingeführt,
mit dem die Maschinen 24/7 liefen, ohne angemessene Nacht- und
Wochenend-Zuschläge zu zahlen. Zusammen mit technologischem
Fortschritt bei verbesserten Offset- und Tiefdruckverfahren
wurde dadurch die Produktionskapazität erhöht und Gruner & Jahr
zog die einige Jahre zuvor erworbene Option, den Druckauftrag des
Spiegel an sich zu ziehen. Darum wurde mir zur Einstellung als
erstes gesagt: Wenn ihr ausgelernt habt, geht der Spiegel an
Gruner & Jahr und ihr Azubis werdet nicht übernommen. So kam es
dann auch. Wobei der Spiegel-Auftrag nur ein Teil des Grundes
war, man kann sogar sagen, nur ein Vorwand.
Springer hatte genug Arbeit?
Ja,
in den drei Jahren meiner Ausbildung hat Springer
durchaus neue Aufträge akquiriert. Aber in den drei
Jahren wurden ganz viele Arbeiten in der Druckvorstufe, wo ich
ausgebildet wurde, rationalisiert Stichwort OT-Verfahren
und vor allem an Kleinstbetriebe, die oft von ehemaligen
Mitarbeiter*innen geführt wurden, ausgelagert. Die aktuellen Teile,
die sehr genau in die redaktionellen Abläufe eingebunden produziert
werden mussten, blieben im Haus, alles andere, wie etwa die
in der Produktion aufwändigen Werbeanzeigen, wurden als
Werkaufträge extern vergeben.
Rationalisierung und Auslagerung um den Profit zu erhöhen?
Als
ich ausgelernt hatte, wurde rund ein Drittel der
Belegschaft entlassen beziehungsweise mit Abfindungen und
Vorruhestandsregelungen aus dem Arbeitsleben gedrängt.
Der
Betriebsrat rechnete damals vor, dass alle gehalten werden könnten,
wenn die externen Aufträge wieder ins Haus geholt werden, aber die
waren halt billiger, weil dort keine Tariflöhne galten und die
Betriebe oft auf einer Abrufbasis arbeiteten. Einige meiner
Mit-Azubis waren nach der Ausbildung bei solchen Betrieben auf der
Liste. Im Betrieb stand das Gerät, wenn es einen Auftrag gab, wurden
sie angerufen und auf Stundenbasis
bezahlt.
Und die Belegschaft hat sich dagegen nicht offen gewehrt?
Der
Widerstand im Betrieb gegen die Entlassungen war ziemlich handzahm.
Wie das mit dem Betriebsrat rechtlich so ist. Das
Unternehmen entscheidet, wie viele gehen müssen, der Betriebsrat
darf mitreden, nach welchen sozialen Kriterien ausgewählt wird, wer
gehen muss. Gelingt es ihm, die Älteren mit Abfindungen und
Vorruhestandsregelungen zufrieden zu stellen und den jüngeren eine
Weiterbeschäftigungsperspektive zu bieten, ist der Betriebsrat
zufrieden. Auf eine echte Konfrontation wollten sie sich nicht
einlassen und ich vermute, die Belegschaft war dafür auch nicht
geschlossen genug. Entsprechend angespannt waren die freigestellten
Betriebsräte und meine Auseinandersetzung mit dem Personalchef über
meine Übernahme musste ich vor Ort nahezu alleine
austragen.
Hattest du einen Rechtsanspruch auf Übernahme?
Als
Mitglied der Auszubildenden- und Jugendvertretung, der an
Betriebsratssitzungen teilgenommen hat, hätte der Betrieb
mich eigentlich auf mein Verlangen übernehmen müssen. Aber der
für mich zuständige Freigestellte weigerte sich offen, an dem
Gespräch als Zeuge teilzunehmen, weil er nicht ins offene Messer
laufen wollte. Der für Drucker zuständige Freigestellte ging
dann doch noch mit. Unter den Bedingungen, keinen Rückhalt zu haben,
habe ich mich dann letztlich auch
mit Geld abfinden lassen aber
dabei immerhin den
Preis von zuerstangebotenen 2.500 auf 10.000 DM hochgetrieben.
Insgesamt
herrschte beim Springer Verlag, nachdem der Gründerchef Axel
Springer gestorben war und das ganze zur Aktiengesellschaft geworden
war, bei vielen die Vorstellung vom guten alten Springer, der
familiär-patriarchal für das Wohl seiner Arbeiter gesorgt habe. Der
neue neoliberale Ton im Betrieb wurde dem Wandel zur
Aktiengesellschaft zugeschrieben: Die buchhalterische
Aufteilung in Crop-Center, also jeweils für sich
profitabel arbeiten müssende Abteilungen, gerade auch in
Konkurrenz zu anderen Abteilungen gerechnet, setzte jede Abteilung
unter Druck,
für sich Gewinn abzuwerfen, sonst wurde ausgelagert, wie ich es
schon geschildert habe.
Keine guten Aussichten für Gegenwehr
Klassenbewusstsein
gab es nur noch vereinzelt. Das hing sehr von der Abteilung und dort
auch noch der Schicht ab. Ich erinnere mich, dass es eine
Schicht in der Montage gab, der Abteilung, wo Text und Bild
zur Vorlage für den fertigen Druckbogen zusammengefügt werden, wo
es Mitglieder der DKP, der Deutschen Kommunistischen
Partei, gab, die mit mir als Lehrling politische Gespräche
anfingen. Und es gab eine Schicht in der Elektronischen
Bildverarbeitung, die kämpferisch war und mich bei meinem Kampf um
die Übernahme unterstützte. In
der Elektronischen Bildverarbeitung war
es vor allem eine Genossin, die auch Betriebsrätin war, aber
nicht freigestellt, die mir mal erzählte, dass sie
früher als sie bei Broschek Druck gearbeitet
hat, Mitglied im KB, dem Kommunistischen Bund war, deswegen sie
zuerst aus der Gewerkschaft ausgeschlossen und dann vom
Betrieb entlassen worden war. Aber dann konnte sie bei
Springer anfangen zu Arbeiten. Im KB war sie zu dem Zeitpunkt
aber nicht mehr. Jedenfalls war das eine Schicht wo alle dahinter
standen, dass alle Azubis zumindest für drei Monate
übernommen werden sollten, um einen ordentlichen Start ins
Berufsleben zu haben und die sich trotz Produktionsdruck nicht davon
abbringen ließen, den Azubis was zu zeigen und beizubringen.
Gedanken
zu Klasse und Kampf
Die
Klassenverhältnisse sind nicht verschwunden, sondern entrechteter
und flexibilisierter worden. Dass es kaum kollektiven Klassenkampf
von unten gibt ist kein Grund, den antagonistischen Widerspruch
zwischen Kapital und Arbeit zu übersehen.
Sicher
habe ich einiges vergessen von den frühen Einführungen in die
Kritik der politischen Ökonomie, von den Schulungstexten Lohn,
Preis, Profit und Lohnarbeit und Kapital von Karl Marx, die wir
in den Jugendgruppen des Kommunistischen Bundes gemeinsam gelesen
haben, aber die eigene Erfahrung nicht. In der Grafischen Jugend
haben wir während meiner Lehre und später der Arbeit als
ausgelernter Drucker über ein Verbot der Nachtarbeit in der
Druckindustrie gesprochen. Die Studierenden in meiner WG haben die
Probleme durch die Dreischichtarbeit nur ansatzweise verstanden. Wenn
sie lange frühstücken wollten, war an Schlaf nicht zu denken. Für
sie waren meine Arbeitsbedingungen einfach außerhalb ihrer
Vorstellungswelt. Dabei kellnerten oder jobbten sie selbst auch.
Meine
Lehre und Arbeit als Drucker war das eigentümliche Gegenstück zu
meinen späteren Arbeitserfahrungen in linken Verlagen und Zeitungen.
Während in der Druckerei darauf geachtet wurde, die Arbeitskraft
möglichst teuer zu verkaufen und politische Fragen darüber hinaus
kaum eine Rolle spielten, so ging es in den alternativen Betrieben
nur um politische Fragen, ohne den Verkauf der Arbeitskraft zu
thematisieren. Eine Hinterfragung der durch die Besitzverhältnisse
determinierten Entscheidungsstrukturen habe ich bisher nicht erlebt.
Meine Lohnarbeit begann in einer Phase des Rollbacks in fast allen
Bereichen, nachdem es in den 60iger Jahren in der Hochphase der
fordistischen Massenproduktion gerade an den Fließbändern eine
Phase der Revolte und der harten, auch wilden Streiks quer durch
Westeuropa gab. Und parallel Aufbrüche im Gender, im universitären,
(sub-) kulturellen Bereich und in der Reproduktion. Die Lohnquote am
gesellschaftlichen Eigentum stieg, es gab eine Umverteilung von oben
nach unten. Auch deswegen forcierten die Kapitalbesitzenden den durch
die Entwicklung der Mikroprozessoren technisch plötzlich möglichen
Umbau weg von der fordistischen Großserienproduktion für
Standardmilieus hin zur postfordistischen Kleinserienproduktion für
sich auch dadurch im Konsum ausdifferenzierende Submilieus: Weg vom
reinen Taylorismus, hin zur Kombination von Fließband und
Gruppenarbeit. Weg vom tarifvertraglich regulierten
Normalarbeitsverhältnis hin zur Spannbreite vom prekären
Teilzeitjob bis zur ausgebauten privilegierten
Innovationsmittelschicht. Die Klassenverhältnisse sind dabei nicht
verschwunden, sondern entrechtet und flexibilisiert worden. Weg vom
nationalen Markt hin zum globalisierten kapitalistischen Weltsystem,
mit seinen immer schon existierenden, mittlerweile aber stark
ausgebauten Produktions- und Wertschöpfungsketten über Grenzen
hinweg. Klassenkampf macht so nationalstaatsbezogen keinen Sinn mehr,
sowohl das Zusammenfließen der Klassenkerne als auch der Kämpfe hat
immer auch eine transnationale Ebene. Durch die technologische
Entwicklung wurde eine Internationalisierung von Produktionsabläufen
möglich, mit der von den Besitzenden der Produktionsanlagen eine
extreme Zunahme von entgrenzter Konkurrenz durchgesetzt wurde: Mit
der zunehmenden weltweiten Standortkonkurrenz zwischen den nationalen
Wettbewerbsstaaten wurden funktionierende nationale Absatzmärkte und
deren Stabilisierung durch garantierte Lohnquoten und Sozialstaat
überflüssig. Austeritätspolitik und Deregulierung ermöglichten
auch in den kapitalistischen Metropolen den Ausschluss ganzer
Bevölkerungsgruppen aus der gesellschaftlichen Teilhabe, wie sie bis
dahin nur in den Staaten der Peripherie im Süden üblich war. Durch
die Entgarantierung traditioneller Lohnarbeitsverhältnisse in
Vollzeit brach auch die Rolle des Familienernährers auf. So kam es
nicht nur zur materiellen Verunsicherung der männlichen weißen
Facharbeiter, sondern auch zu neuen flexiblen Chancen für Frauen,
Eingewanderte, Minderheiten, niedrig wie höher Qualifizierte im
Bereich der Lohnarbeit.
Dass
diese Chancen genutzt werden, ist nicht die Ursache der Abwertung der
männlichen weißen Arbeiter. Ebenso wenig wie ein nebulöser
Neoliberalismus: Ein Begriff wie ein Feindbild, der nicht
politökonomisch hergeleitet wird, sondern mit Ressentiments gegen
die da oben gegen die ein Prozent, die Eliten einhergeht. Und
von einer ideologisch motivierten Trennung von produktivem Industrie-
versus spekulativem Finanzkapital ausgeht, die es in der grausamen
politökonomischen Realität nicht gibt. Charakteristisch sind die
fließenden Übergänge zwischen Industrie- und Finanzkapital.
Antikapitalismus braucht eine radikale Kritik der politischen
Ökonomie, die auf der Ablehnung der Lohnarbeit und des stummen
Zwanges in sie basiert. Es gilt, Verteilungskämpfe innerhalb des
Kapitalismus, darum, sich möglichst teuer zu verkaufen, nicht als
den ganzen Klassenkampf zu verstehen. Es ist bestenfalls der Halbe
und wird erst dann eine runde Sache, wenn in die Verteilungskämpfe
das Aufbegehren gegen die Lohnarbeit, gegen Ausbeutung, Entfremdung
und Zwang eingeschrieben ist. Sonst sind es legitime, notwendige,
aber nicht an den notwendigen Bruch mit dem Kapitalverhältnis
anschlussfähige Verteilungs-, gegenwärtig meist Abwehrkämpfe.
Klassenkampf ist nicht denkbar ohne die Absicht, die
Klassenverhältnisse positiv in einer ausbeutungsfreien Gesellschaft
aufzuheben. Dies im Bewusstsein darum, dass die Arbeiterklasse in
Deutschland im Nationalsozialismus negativ in die Volksgemeinschaft
der Täter*innen der Shoah überführt wurde. Die Arbeiterklasse für
sich oder Fragmente von ihr kann und können sich nach dieser
Geschichte nur als sozialer Prozess neu konstituieren, mit einer
transnationalen, antideutschen und antiherrschaftlichen Ausrichtung.
Die Vorstellung einer statischen Klasse, wie sie im
Arbeiterbewegungsmarxismus verstanden wird, ist obsolet.
Traditionelle Linke behaupten gerne die Existenz der Klasse für
sich, um etwas zum vertreten zu haben, eine Legitimation für ihre
Stellvertreterpolitik. Eine Arbeiterklasse für sich, als politisches
Subjekt der Befreiung, als Selbstermächtigung, ist aber nur
punktuell als verdichtetes Kräfteverhältnis möglich, nicht als
quasi institutionalisierte soziale Einheit. Arbeiterklasse als
politisches Subjekt hat und ist keine unveränderliche Essenz,
sondern kann im Moment des Ausbruchs, des widerständigen sich
Findens zusammenkommen, eine kritische Masse werden. Hilfreich können
dafür Organisationen sein, Träger*innen von Flaschenpost voller
Erfahrungen aus Kämpfen und der marxistischen Kritik der politischen
Ökonomie – antagonistischer Theorie.
Klassenkampf
ist nicht mit einer kapitalismusimmanenten Zielvorstellung denkbar.
Durch die Perspektive des Bruchs mit der Kapitalverwertung an sich,
durch sein revolutionäres Moment ist Klassenkampf an den Bruch mit
dem umweltzerstörerischen Wachstumsfetischismus der
Kapitalverwertung anschlussfähig. Der Kampf gegen die Lohnarbeit
kann mit dem Kampf gegen die Klimazerstörung zusammengehen, wenn
beides radikal gedacht wird. Sonst nicht. Gegen die Vernutzung der
Natur, gegen die Vernutzung der Lohnarbeitenden. Das Eine macht ohne
dass Andere auch keinen Sinn.
Wichtig
ist dabei, Befreiung von der Lohnarbeit und der Naturzerstörung von
unten heranzugehen. Nicht über die Apparate von Wahlparteien, welche
durch die Parlamentsarbeit dominiert werden, sondern über soziale
Bewegungen von unten, über radikale, organisierte Kerne in ihnen.
Gaston
Kirsche